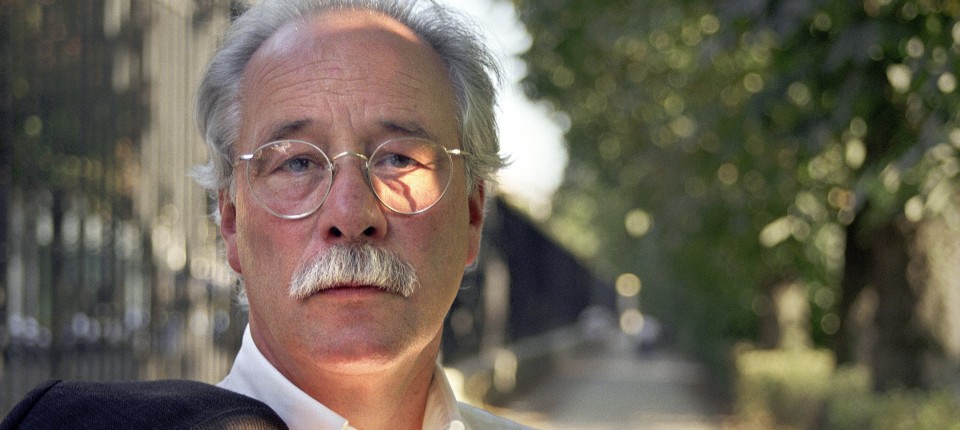
Sebald - ein Kannibale?
Man wirft ihm vor, ein kannibalisches Gewerbe gepflegt zu haben: kulturelle Aneignung. Insbesondere bei Angiers SPEAK, SILENCE
 ist dies ein Hauptthema.
ist dies ein Hauptthema.
Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Matz bestreitet das.

Seine Vorstellungsrede vor der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung beendete W.G. Sebald 1996 so:
„Einmal, in einem Traum, wurde ich schon, wie Hebel, gleichfalls in einem Traum, in Paris als Landesverräter und Hochstapler entlarvt.
Nicht zuletzt aufgrund solcher Befürchtungen ist mir die Aufnahme in die Akademie willkommen als eine unverhoffte Form der Legitimation.“
Ist es jetzt so weit? Man könnte es glauben, wenn man die Polemik verfolgt, die aus Amerika herüberschwappt - Süddeutsche:

Auslöser der Debatte ist „Speak, Silence“ von Carol Angier, die erste große Sebald-Biographie,
die im kommenden Jahr auch auf Deutsch erscheinen wird. Das Buch ist Sache der Rezensenten. Doch schon jetzt vermischen sich Kritik an Angier,
Polemik gegen den Schriftsteller und politische Kurzschlüsse zu einem Ganzen, das so nicht stehen bleiben kann.
Stephan Wackwitz urteilte in der „taz“ kurz und bündig: „Als politisch-moralische Instanz hat Sebald wenig Glück, und er ist in dieser Rolle vermutlich nicht zu retten.“
Sebald eine „politisch-moralische Instanz“? Um ein Denkmal zu stürzen, wird es hier erst errichtet. Mag sein, dass in den Vereinigten Staaten auf eine besonders
emphatische Rezeption nun der unvermeidliche Rollback erfolgt, doch in Deutschland? Und sogar der absurde Superlativismus, Sebald sei
„the German writer who most deeply took on the burden of German responsability for the Holocaust“, ist trotz allem niemals dem Gelobten selber anzulasten.
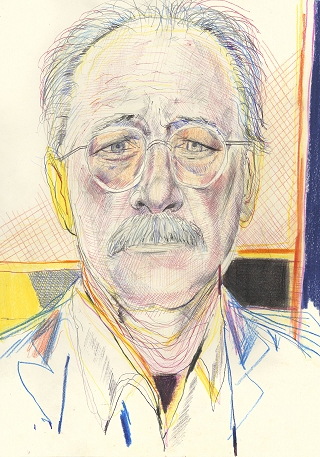 Nimmt man Ben Lerners „The Storyteller“ in der „New York Review of Books“, den bislang gründlichsten Aufsatz zur Sache, dann geht es kurz gesagt
um zwei Vorwürfe: erstens um Sebalds Umgang mit verschwiegenen Quellen und die Vermischung von Realität und Fiktion; zweitens um seinen
„paranoischen Pantragismus“, also das nivellierende Bild einer ständigen Katastrophe, in der alle realen geschichtlichen und politischen Katzen im Grau
in Grau der Melancholie verschwinden. Das wäre sicherlich die wesentliche Frage, ist jedoch eine der literarischen Kritik und hat nichts zu tun mit einem
illegitimen Anspruch des Autors Sebald.
Nimmt man Ben Lerners „The Storyteller“ in der „New York Review of Books“, den bislang gründlichsten Aufsatz zur Sache, dann geht es kurz gesagt
um zwei Vorwürfe: erstens um Sebalds Umgang mit verschwiegenen Quellen und die Vermischung von Realität und Fiktion; zweitens um seinen
„paranoischen Pantragismus“, also das nivellierende Bild einer ständigen Katastrophe, in der alle realen geschichtlichen und politischen Katzen im Grau
in Grau der Melancholie verschwinden. Das wäre sicherlich die wesentliche Frage, ist jedoch eine der literarischen Kritik und hat nichts zu tun mit einem
illegitimen Anspruch des Autors Sebald.
Der erste Vorwurf aber ist, mit Verlaub, ein alter Hut, wenn auch neu aufgebürstet im zeitgemäßen Aneignungs-Generalverdacht. Ein alter Hut in Bezug auf Sebald,
denn diese kritischen Fragen haben sein ganzes erzählerisches Werk begleitet, wurden auch von ihm selbst immer wieder diskutiert – ausführlich nachzulesen
etwa in der Interviewsammlung „Auf ungeheuer dünnem Eis“. Selbstverständlich wird all das auch weiterhin diskutiert werden, aber der skandalisierende
Enthüllungsgestus, man habe jetzt endlich Belastendes aufgedeckt, das den Delinquenten künftig als „politisch-moralische Instanz“ disqualifiziere, ist Pose.
Sebald hat reale Figuren aus Geschichte und Gegenwart als Vorbild genommen und in seine Erzählwerke verpflanzt? Aber was um Himmels willen tut ein Roman
denn sonst, dieses nach Walter Benjamins zeitloser Definition „zusammengestoppelte Unding aus Erlebtem und Ausgedachtem“? Hat Stendhal für Julien Sorel
nachgefragt bei den Hinterbliebenen des guillotinierten Antoine Berthet? Flaubert bei denen von Madame Delamare, bevor er sie als Emma Bovary unsterblich machte?
Goethe bei Werthers Lotte? Zu schweigen von all den unbekannten Tanten, Geschwistern, Kollegen, Nachbarn. Es hilft nichts: Der Romancier pflegt ein kannibalisches
Gewerbe, es ist gefährlich, in seiner Nähe zu leben. Sebald habe alles getan, um seinen Erzählwerken den Anschein des Wahren, Realen zu geben?
Welcher Autor täte oder zumindest versuchte das nicht? An die Realität der Emma Bovary glaube ich aber nicht wegen Delphine Delamares Grabstein im
Dörfchen Ry, dem „Vorbild“ für Yonville l’Abbaye, sondern wegen der bezwingenden Kunst des Romanciers Flaubert!


Blicken wir, um nicht nur allgemein zu antworten, auf die am häufigsten zitierten „übernommenen“ Figuren bei Sebald, auf Dr. Selwyn und Jacques Austerlitz.
Beide sind klassische Beispiele für zwei entgegengesetzte Verfahren. Bei Dr. Selwyn in „Die Ausgewanderten“ dachte Sebald an die Gestalt seines Vermieters
in Abbotsford, machte die Figur selbst aber zu etwas ganz anderem: zu einem jüdischen Emigranten. Bei Jacques Austerlitz nahm Sebald die Grundkonstellation
eines Fluchtschicksals zum Anstoß, übertrug diese jedoch auf eine vollkommen andere, fiktive Person. Bald nach Erscheinen von „Austerlitz“ und nach Sebalds
Unfalltod im Dezember 2001 erhob Susi Bechhöfer in dem Aufsatz „Stripped of My Tragic Past by a Bestselling Author“ den Vorwurf, Sebald habe ihr ihre
Lebensgeschichte gestohlen.
 Der Vorwurf erreichte natürlich auch den Verlag, doch nach der Lektüre von Susi Bechhöfers Buch „Rosas Tochter“ war schon damals meine Antwort als Lektor eindeutig:
Bei einem Menschen mit Bechhöfers schrecklicher Erfahrung war die Panik allzu verständlich, man wolle sie ein weiteres Mal berauben. Für den außenstehenden
Leser sind es jedoch zwei vollkommen verschiedene Geschichten über denselben historischen Gegenstand. In „Rosas Tochter“ geht es um jüdische Zwillingsschwestern,
die mit einem Kindertransport 1939 gerettet werden und nach England kommen; bald schon wird Susi von ihrem Ziehvater sexuell missbraucht, und die Aufarbeitung
dieser katastrophalen Erfahrung nimmt einen Großteil des Buches ein. Nichts davon in „Austerlitz“. Der kleine Jacques Austerlitz teilt das Lebenstrauma von
Verfolgung und Rettung durch den Kindertransport, das englische Pfarrhaus, alles andere aber hat kaum etwas zu tun mit Susi Bechhöfers Geschichte.
Der Vorwurf erreichte natürlich auch den Verlag, doch nach der Lektüre von Susi Bechhöfers Buch „Rosas Tochter“ war schon damals meine Antwort als Lektor eindeutig:
Bei einem Menschen mit Bechhöfers schrecklicher Erfahrung war die Panik allzu verständlich, man wolle sie ein weiteres Mal berauben. Für den außenstehenden
Leser sind es jedoch zwei vollkommen verschiedene Geschichten über denselben historischen Gegenstand. In „Rosas Tochter“ geht es um jüdische Zwillingsschwestern,
die mit einem Kindertransport 1939 gerettet werden und nach England kommen; bald schon wird Susi von ihrem Ziehvater sexuell missbraucht, und die Aufarbeitung
dieser katastrophalen Erfahrung nimmt einen Großteil des Buches ein. Nichts davon in „Austerlitz“. Der kleine Jacques Austerlitz teilt das Lebenstrauma von
Verfolgung und Rettung durch den Kindertransport, das englische Pfarrhaus, alles andere aber hat kaum etwas zu tun mit Susi Bechhöfers Geschichte.
Sebald selbst hat nie ein Geheimnis gemacht aus seinem Verfahren. Noch in einem seiner letzten Interviews, unmittelbar nach Erscheinen von „Austerlitz“,
sagte er öffentlich das Gleiche, was er auch auf meine Frage nach „realen Vorbildern“ für die Kunstfigur Jacques Austerlitz geantwortet hatte:
„Es stecken zweieinhalb Lebensgeschichten in ihm, Biographien, denen ich nachgegangen bin.“
Der allgemeine Verdacht der „kulturellen Aneignung“ hat nun aber auch Sebald erfasst: Ist es tatsächlich, wie Wackwitz schreibt, „übergriffig“ und „unangemessen“,
wenn ein Nachgeborener fiktiv, literarisch über den Holocaust schreibt und dabei Zeugnisse von wirklichen Opfern verwendet? Die letzten Zeitzeugen verschwinden,
und mit ihnen verschwände die Katastrophe des Jahrhunderts aus der Literatur. Jorge Semprún hat vor einigen Jahren Jonathan Littells „Die Wohlgesinnten“
leidenschaftlich gegen einen ähnlichen Vorwurf verteidigt: „Ohne Romane stirbt das Erinnern.“ Romane, die sich natürlich stützen müssen auf Berichte,
Zeugenaussagen, Dokumente.
Sebald hat noch 2001 das, was jetzt skandalisiert werden soll, als seinen wesentlichen Schreibimpuls dargestellt:
„Ich glaube, dass gerade an der Nahtstelle zwischen Dokument und Fiktion die interessantesten Dinge entstehen. Das lässt sich an der dokumentarischen Welle
der deutschen Literatur zeigen, die es in den 60er, 70er Jahren gab, von Peter Weiss bis Alexander Kluge. Es zeigte sich bald, dass es sich auch dabei
nicht um unverstellte Dokumente handelt.“ Dem kann man kritisch widersprechen. Moralisch anfechtbar ist eine Literatur aus Dokument und Fiktion trotzdem
bei keinem Autor, auch nicht bei Sebald. Die unreflektierte Ideologie der „kulturellen Aneignung“ beschädigt nicht nur Autoren, sie beschädigt die Literatur.
FAZ.net 29.12.2021
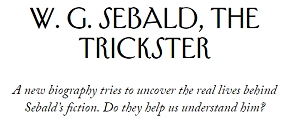

|
|
