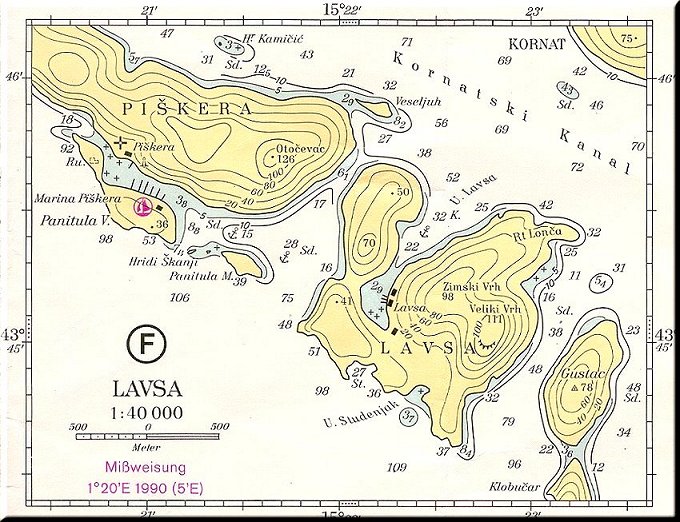Zwischen Dugi Otok und Zirje, um die Mutterinsel Kornat gruppiert,
sitzen sie auf dem Wasser wie Blasen, die sich von einem riesigen
Unterwassergelände gelöst haben, auf Anhieb unmöglich zu unterscheiden,
von spärlicher Vegetation und fast alle unbewohnt. Um ihre Anhöhen sind
ein paar Kränze buschigen Bewuchses geworfen, und zwischen Karst und Kalk
ziehen Trockenmauern bleiche Grenzlinien, als schaffe die Kargheit allein
nicht schon klare Verhältnisse. Das Licht bricht schnell hervor. Am Fuße
des Inselchens reflektiert es tief in den Grund, flimmert auf den
Kieselsteinen im Uferabfall, blitzt in einem Schwarm Sardinen auf, aber im
Netz, das Smirka mit den Händen über das Heck zieht, glänzen nur drei
Fische. In der Stille des Morgens glaubt man sie atmen zu hören, bevor sie
sich in zuckenden Schlägen gegen die Wand des Eimers werfen, ein Echo
hinterlassend wie ein akustisches Warnzeichen für alle Lebewesen, im
trügerischen Frieden auf den Menschen zu achten. Als wäre ein Bann
gebrochen, wirft Smirka den kleinen Außenbordmotor an und tuckert zurück
zur Bucht, die Möwen fliegen auf und umkreisen den mageren Fang, die Sonne
hat sich über den Horizont erhoben, Libellen sind erwacht, Wasser und
Himmel sind nun blau. Aus dem Weltall haben die Astronauten berichtet, die
Adria sei der blaueste Fleck auf der Erde.
Smirka zeigt auf Olivenhaine, 50-jährige Bäume neigen ihre verknoteten
Äste zur Erde. Viele seien es nicht mehr, sagt sie, aber wer solle noch
kommen und mithelfen bei der Ernte. Die Felder auf den Kornaten sind
Eigentum der Bewohner der Insel Murter, die über eine Brücke mit dem
Festland verbunden ist. Vor gut hundert Jahren kauften die Murteriner den
Adligen der Küstenstadt Zadar die Inseln als Weideland ab, und über
fünfzig Jahre ist es her, dass Smirka sich, frisch verheiratet, in den
Frondienst der Murteriner Fischer und Bauern einreihte, die mit
einfachstem Werkzeug den Boden rodeten. Stein für Stein, sagt Smirka, habe
sie mit Zlavko, ihrem Mann, aus dem Boden gehoben. Die 20 Seemeilen
zwischen Murter und ihren Feldern auf den Kornaten seien sie gerudert,
jeder sei damals gerudert, und nicht jedes der kleinen Boote sei
angekommen. Schafe, Ziegen und der Erde abgerungene Haine, davon lebten
die eigenwilligen Pioniere, die ihre Unterkünfte in die geschützten
Buchten der Inseln gebaut hatten, frühmorgens auf Makrelenfang gingen und
danach mit der Hacke aufs Feld. Sie setzten den Most an, brannten den
Schnaps, pressten die Oliven, stampften aus den Pflanzen die Farbe, aus
den Agaven die Fasern. Ein unscharfes Foto in einem Buch mit dem Titel
Jugoslawien zeigt Smirka in der Mitte von Männern als einzige Frau:
beim Dreschen der Blätter und Pflanzen, ein Bild wie aus Bertoluccis Film
1900. Die Botschaft der lachenden Gesichter triumphiert über die
bescheidenen Verhältnisse. Acht Monate im Jahr bestellten sie ihre
»überseeischen« Felder, dann überließen sie den Winterstürmen das
vernagelte Haus und kehrten zurück in den Schutz des Ortes Murter.
Heute bringt ein Fischkutter zweimal pro Woche Nahrungsmittel und
alles, was Smirka und die anderen Sommerbewohner per Handy ordern, auf die
Inseln. Und in den Monaten von Juni bis September bringt er noch etwas:
Touristen. Nicht weit von Smirkas und Zlavkos Häuschen ist eines jener
Ferienhäuser zu mieten, die im örtlichen Tourismusbüro unter dem Namen
»Robinsonade« laufen und über den Archipel verstreut sind. Es sind nicht
allzu viele, und sie sind die einzige Möglichkeit, hier buchstäblich Fuß
zu fassen, denn Kroatien hat das über 200 Quadratkilometer umfassende
Inselreich vor allem den Seglern geöffnet. In der Nebensaison noch als
einzelnes Modell zu bewundern, vermehren sich im Hochsommer die Jachten,
Katamarane und Segelboote zu einem Wimmelbild. Täglich fahren 130 Schiffe
die Marinas an, jene Jachthäfen auf den Inseln Zut und Piskera, die,
großzügig angelegt, einer Freiluftanlage eines guten Hotels gleichen. Die
Kornaten sind schon lange kein Geheimtipp mehr; dass sie immer noch als
solcher gehandelt werden, liegt an ihrem exklusiven Zugang vom Wasser aus.
Die Umweltbehörde kontrolliert die Einhaltung der Bebauungsregeln selbst
auf den größeren Inseln bislang erstaunlich konsequent. So genießen die
Bootseigner das Privileg, mit ihrem schwimmenden Gehäuse leicht vor Anker
gehen zu können. Im Austausch hierfür die 16 im Nationalpark geltenden
Benimmregeln einzuhalten ist nicht viel verlangt. Doch die Vorstellung,
die Macht des Schicksals und des Geldes könne ihr eines Tages über dem
Kopf ihres Häuschens eine Apartmentanlage bescheren, lässt Smirka Zuflucht
zur Gnade ihres Lebensalters nehmen, das ihr aller Wahrscheinlichkeit nach
diesen Anblick ersparen wird.
Den zwei Marinas stehen sie in Schönheit nicht nach: die privaten
kleinen Anlegehäfen, in Buchten versteckt, nicht mehr als ein Restaurant
mit fünf Tischen, papiernen Spitzendeckchen, einer handgemalten
Speisekarte und einem Service zwischen hoch sympathischer Improvisation
und Geschäftssinn. Ivo war zehn Jahre Fischer, bevor er sein sommerliches
Gasthaus baute. Um es fertig zu stellen, ging er noch fünf Jahre als
Werftarbeiter nach Hamburg. Seine Deutschkenntnisse wissen die Gäste zu
schätzen. Aber nach ein paar Schnäpsen sprechen sie mit ihm, als sei er
Analphabet. »Ich kenne die Deutschen ganz gut«, sagt er und stellt
frühmorgens ein frisch gezapftes Karlovacko auf den Tisch. Er lässt offen,
was er genau damit meint. Er deutet auf das Krokodil an seinem Polohemd:
»Meine Frau sagt: 'Besser, du machst da ein Chamäleon hin!'« Ivo will
alles tun, damit es mit Kroatien westwärts vorangeht.
Gleich an der Mole findet sich ein Fischbassin mit dem Besten, was die
allmählich abgefischte Adria hergibt: Da tasten die Langusten sich zu den
Krebsen hin, Hummer öffnen vorsichtig die Scheren, und eine orangerote
Seltenheit schwimmt verwundert im beengenden Geviert: die Skrpina, der
Rote Drachenkopf. Wer so einen Fang macht, verkauft ihn sofort an die
Restaurants, ein halbes Kilo von diesem Fisch bringt im Verkauf so viel
wie drei Kilo bestes Ziegenfleisch.

Man muss aber nicht von einer dreistöckigen Jacht springen, mit dem
Finger auf eines dieser ausgestellten Meerestiere zeigen und den Wirt in
Marsch setzen, dass er es für einen auf den Grill wirft. Man kann auch in
großer Ruhe an solchen Orten sitzen, von Freude erfüllt, hier den
Drachenkopf zu finden, den man noch nie zuvor gesehen hat. Und was um
einen herum so geschieht, wenn die Boote ihre Menschen entlassen, ganz
ungeachtet der an den Masten aufgezogenen Nationalfähnchen, ist ein
Panoptikum, bei dem man gern noch ein Getränk nachbestellt. Wird man der
leibhaftigen Gesichter müde, vertieft man sich in jene Schemen, Fratzen
und Titanen, die sich im Bruch des Felsgesteins zu Szenen formen. Als sei
man ein entrücktes Kind und erhasche in den Wolkenfetzen herbeistürmende
Gestalten. Im Schatten dieser imposanten Tafelberge liegen andere, sanfter
geformte Inseln, von denen manche in großer Bescheidenheit eine Flora von
160 Pflanzenarten hüten, fast vergessen.
Die betörende Natur hat ihr Ende nicht an den Grenzen des
Nationalparks. Der nordwestliche Rand der Insel Kornat ist nur durch eine
schmale Wasserscheide von der Nachbarinsel Dugi Otok getrennt. Über die
administrative Grenzziehung hinweg findet das Paradies dort seine
Fortsetzung. Die Telascica-Bucht, die zu Dugi Otok gehört, ist so etwas
wie ein informelles Anhängsel an den Kornati-Park und nennt sich
Naturpark. Per Schiff muss man nur von einem Gebiet aus- und in das andere
einfahren und dabei links und rechts nach Patrouillenbooten spähen. Wer
kein Schiff hat, muss den Umweg übers Festland nehmen, um von der Stadt
Zadar mit dem Tragflächenboot nach Dugi Otok zu gelangen. Aber diese
kleine Unterbrechung ist wie eine notwendige Pause von allzu großer
Schönheit. Schönheit braucht Brüche, sonst macht sie schrecklich
schläfrig. Der Ort Sali auf Dugi Otok ist eine ideale Mischung: Nahe genug
an der landschaftlichen Faszination, hat das 1500-Seelen-Dorf die
Infrastruktur des Alltagslebens. Und obwohl hier ganze Schulklassen von
Touristen zum Tauchlehrgang kommen, scheint es wie in geheimer Absprache
nicht zum Exhibitionismus bereit, als böte es den Fremden höflich den
Vorplatz an, nicht aber das Haus.
Die Telascica-Bucht steht wie der Kornati-Park seit 1980 unter der
Kontrolle der kroatischen Umweltbehörde. Hier arbeitet Nikola, ein
»Indigena« wie er sagt, denn seine Familie wohnt seit Generationen in
Sali. Sein sorgsamer Umgang mit der Natur trägt eine Spur von Skepsis, als
müsse er sich ihrer jeden Tag aufs Neue vergewissern, als sei ihre
Harmonie ihm schon einmal abhanden gekommen. Nikola war entschieden länger
von seinem Dorf weg gewesen, als er es jemals gewollt hatte, genau
genommen saß er 1991 in Split und wartete auf das Boot, das ihn nach
Beendigung seines Militärdienstes nach Hause bringen sollte. »Es fehlte
nicht einmal eine Stunde zu diesem verdammten Boot, aber in dieser Stunde
wurden die Grenzen geschlossen und zack, alle zurück in die Kaserne«, sagt
er und schüttelt wegen dieses zeitlichen Zusammenspiels den Kopf. Nein,
von den Kämpfen sind die Inseln verschont geblieben, getroffen hat sie nur
der Einberufungsbefehl für die meisten Männer. Aber das reichte wohl, um
die unberührte Schönheit der Landschaft in einen Bezug zu stellen. Wer der
Natur sehr nahe ist, sieht schnell, wenn der Pakt zwischen ihr und den
Menschen gebrochen ist. Zurückgekehrt aus dem Krieg, hat Nikola sich ihrem
Schutz verschrieben, als wolle er sich fortan nur noch um das kümmern, was
vor seiner Haustür liegt.
Aber manchmal geht sein Temperament mit ihm durch, und aus dem Schutz
wird große Liebe. Dann zieht er mit dem Motorboot rasante Kurven, schert
sich nicht um die merkwürdige Wassergrenze zwischen Nationalpark und
Naturpark und gestikuliert wild nach backbord, erst in die Höhe zu den
dramatischen Felsabstürzen und dann ins Meer: 80 Meter fällt die felsige
Wand in die Tiefe, für Taucher sind das maledivische Verhältnisse. Der Arm
zeigt über das offene Meer, dort ist Ancona, drei Stunden nur entfernt -
sollen wir da Kaffee trinken? Aber ach, die Italiener, sie haben es bei
den Kroaten schwer; keine Okkupation in der Geschichte des Landes ist
vergessen, und Italien sitzt einfach immer vor der Nase. Dafür
funktioniert der Naturschutz wunderbar. »Nur zwei Monate im Jahr ist es
Stress«, sagen die Männer von der Umweltbehörde und werfen sich ein
bisschen in Positur. »Wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, kommen
wir eben zu fünft und sagen ihm Bescheid. Wir verlangen 40 Kuna
Liegegebühr pro Tag, das sind fünf Euro, und die Inhaber der größten Boote
sind die, die noch darüber diskutieren. Sie fragen, wofür sie etwas
bezahlen sollen, und dann sagen wir: 'Guck mal, da oben die Sonne und hier
das Wasser, das ganz sauber ist, und in der Mitte, schau mal - das ist
Natur, wie du sie nirgends mehr hast!'« Der Mensch müsse das doch spüren,
meint Nikola, man müsse doch auch einmal still sein.
In Sali kehrt am Abend die Idylle ein. Eigentlich wechselt das Licht
nur von Gelb nach Rot. Über jeder Stufe liegt ein Wurf Gold. Mehr braucht
man nicht, um zu wünschen, man wäre Maler. Ist man kein Maler und muss
demzufolge jetzt nicht an die Arbeit gehen, träumt man. Das ist
Urlaub.
Nur wenige Fischer lenken ihre Boote aus dem kleinen Hafen. Sie schauen
in den Himmel und wiegen die Köpfe, als sei die Ausfahrt bedenklich, aber
diese Miene ist fast ein Ritual, denn nichts anderes könnten sie machen,
als jetzt hinausfahren, wie eine letzte Hingabe an einen verschwindenden
Beruf.
Die jungen Leute setzen auf den Tourismus, der schon im vergangenen
Jahr die Vorkriegszahlen wieder eingeholt hat. Früher war in Sali der Sitz
der Fischereibehörde für das ganze Inselreich. Jetzt bauen die
Fischerfamilien ihre Häuser aus, um Zimmer zu vermieten, und bestellen
zusätzlich ein Stückchen Land. Es scheint zu reichen, denn Sali ist auf
den ersten Blick ein fröhlicher Ort, und die Jungen, die hier geblieben
sind, scheint ein energetisches Netz zu verbinden: Sie spielen Theater und
scheuen vor Shakespeare nicht zurück, sie kleben am Internet, um sich die
Weltgeschichte zusammenzusuchen, und sie halten eine öffentliche
Bibliothek in Topform, deren Bestückung mehr als intelligent ist.

Wer seinen Inselhorizont
trotzdem noch erweitern will, hat es sowieso
nicht weit. Von beiden Enden der Kette, die die Kornaten auf dem Meer
bilden, führt der direkte Weg zur Küste nach Zadar oder Sibenik. Sibenik
rechnet sich zum Nationalpark gleich dazu, erstens weil sein Stadtkern
selbst Weltkulturerbe ist, zweitens weil die nächste geschützte Region
sich im Rücken der Stadt anschließt: die Krka-Wasserfälle.
Wer die scharf gezeichnete Klarheit der Inseln noch vor Augen hat,
findet sich hier in einem gegenteiligen Kosmos. Er betritt dichte
Vegetation, läuft die Ufer eines Flusses ab, dessen Sturzwasser die
Industrialisierung der Region in Gang gesetzt hat. Während die Inseln der
politischen Landesgeschichte entrückt waren, tritt sie hier in
verschiedensten Interpretationen auf: in musealer Folklore, in Klöstern,
Kirchen und versteckten Indizien. Am linken Ufer der Krka steht hoch oben
an der Straße ein Bildnis der Madonna von Visovac. Das Inselchen gleichen
Namens mit dem Franziskanerkloster liegt in der Mitte des Flusses. Die
Madonna gibt es dreimal: einmal im Original, das die Mönche 1445 auf ihrer
Flucht aus Bosnien mitgebracht haben, einmal als Kopie über dem Altar in
der Kirche und nun auch hier am Wege als Schutzheilige für die kroatische
Front. Auf der gegenüberliegenden Bergkette hatten die Serben Stellung
bezogen. Im Kreuzfeuer das schwimmende Kloster. Der Padre, zurückgekehrt
nach 16 Jahren Missionsarbeit im Kriegsgebiet Kongo, fand sein Inselchen
mit zerschossenem Glockenturm vor und das Refektorium zerstört. Welche
Madonna rief er da an, damit sie ihm sage, ob dies ein nachwirkendes
Hirngespinst oder Wirklichkeit sei.
Die Menschen, die ihr Land innig lieben und es auch ab und an mit der
Nation verwechseln, machen die Mienen von Schildkröten, wenn man sie nach
dem Krieg fragt. Smirka zeigt mit dem Daumen auf die eigene Brust und sagt
kurz und rau: »Tito!« Das war ihre Zeit gewesen, was danach kam, konnte
sie nur noch zum Teil verstehen. Nikola macht eine Handbewegung über das
Lenkrad des alten Golfs hinweg und sagte: »Der Krieg - das war! Es muss
jetzt nach vorne gehen!« Und eine zurückhaltende Gesprächspartnerin in
Zadar sagt: »Es ist noch zu früh. Denken Sie an Deutschland. Das braucht
Zeit.«
Wenn die Croatia Airlines von Zadar abhebt, zieht sie eine lange Kurve
an der Küste entlang, bevor sie ins Innere abdreht. Dalmatien ist
wunderschön. Die Astronauten haben Recht: Je höher man kommt, desto blauer
wird das Meer.
Mana, Svrsata, Piskera...
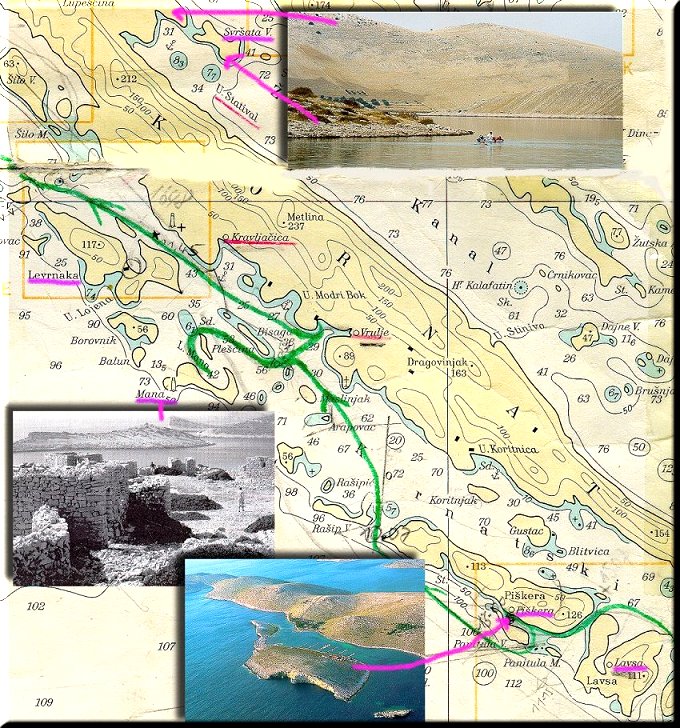
Die Insel Mana zog 1961 ein Münchner Filmteam an, das hier mit Maria
Schell und Cameron Mitchell "Tobendes Meer" drehte. Und
das hat auch seinen Grund: An einem ebenso schrecklichen
wie herrlichen Kliff jagt der Jugo die Brandung bis
40 Meter hoch.
Die Filmstadt, eine griechische Fischersiedlung, die damals als Kulisse entstand,
schaut heute fast echt und uralt aus.
Deutsche Bomber zerstörten alle Häuser auf Lavsa.
Heute stehen wieder ein paar Häuschen mit Zisternen in der windgeschützten großen
Bucht,
die mit dem danebenliegenden Karstfeld sehr schön anzusehen ist und viele Touristenboote
anlockt.
Auch früher schon zog sie die Menschen an, was ein illyrisches Hügelgrab bezeugt.
Die Römer reizte jedoch mehr das Salz, das für die Fischkonservierung nebenan
auf Piskera gerade recht kam. Auch den Partisanen kam diese Insel gelegen - sie bauten
eine Hellinganlage. Es gibt ein kleines Fischlokal, d. h. unter einer stattlichen
Palme steht ein Herd, und die Fische werden am Grill gegart - es schmeckt lecker.
Gegenüber die neugebaute Marina.
 Svrsata: In die nordwestlichen Bucht
laufen 30m voneinander entfernt zwei Mauern parallel (eine davon rechts im Bild!)
30m weit ins Meer hinaus
und werden durch einen 3m hohen und ca. 4m breiten Damm verbunden, der wiederum
3m unter der Wasseroberfläche liegt. Was das einmal war, weiß keiner genau -
vielleicht ein römischer Fischteich.
Svrsata: In die nordwestlichen Bucht
laufen 30m voneinander entfernt zwei Mauern parallel (eine davon rechts im Bild!)
30m weit ins Meer hinaus
und werden durch einen 3m hohen und ca. 4m breiten Damm verbunden, der wiederum
3m unter der Wasseroberfläche liegt. Was das einmal war, weiß keiner genau -
vielleicht ein römischer Fischteich.
Levrnaka ist die viertgrößte der Kornateninseln.
Auf der Kornat zugewandten Seite befindet sich eine große Bucht, die einer
Reuse gleicht. Die Fische können durch den engen, seichten Ausgang
kaum wieder hinausschwimmen. 1922 wurden hier auf ein Mal 22 Tonnen
der "Schlanken" (Pikarell) gefangen.
Gegenüber liegen
die Inseln Piskera und Lavsa.
Auf der Südwestseite Lavsas stehen heute noch zwei kleine
Häuser mit Zisternen und Bootsanlegeplatz. Die Kirche und eine Hirtenhütte
sind die einzigen Reste einer größeren Siedlung, die aus römischer
Zeit stammte und später bis auf 60 Häuser angewachsen war. Es handelte
sich um einstöckige Häuser mit Magazin im Erdgeschoß für Fisch
und Fässer, Schlafraum für die Fischer und Aufbewahrungsort der Netze
darüber. Am Meer (neben den Resten des großen Hauses) befand sich bis
1653 ein dreistöckiger Turm. 1783 gab es sieben Landungsstege und
einen gegenüber, auf dem Inselchen Panitula. Über die dazwischenliegende,
5 in breite Duchfahrt hatte man eine Zugbrücke gebaut.
Auf dem Berg vor der Siedlung thronte ein venezianisches Kastell,
das die Fischer nach dem Untergang Venedigs vernichteten.
Im 16. Jh. wohnte darin der venezianische Fischsteuereinnehmer.
Im 17. Jh. überfielen die Uskoken aus Senj die ankommenden
venezianischen Kaufleute. Während des 2. Weltkriegs befand
sich in der Kirche ein Partisanen-Lazarett.
Heute steht südlich der Siedlung ein Denkmal.
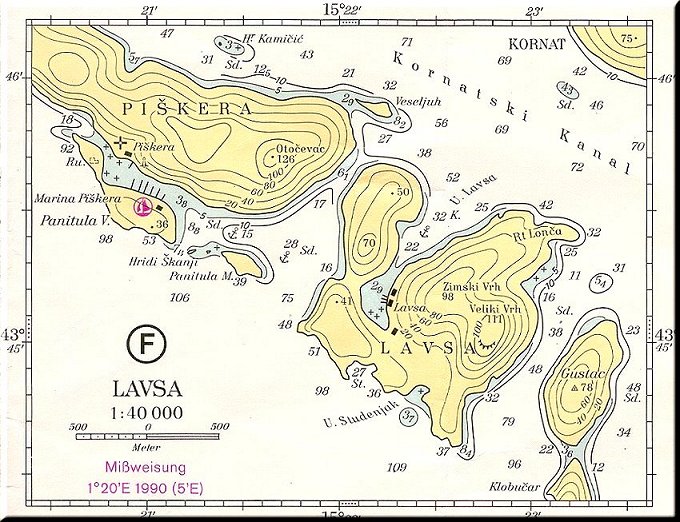





























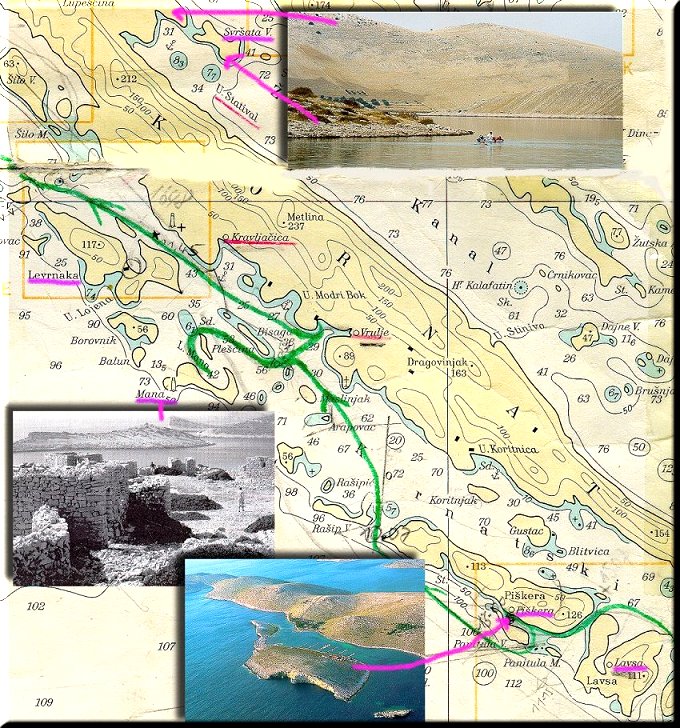

 Svrsata: In die nordwestlichen Bucht
laufen 30m voneinander entfernt zwei Mauern parallel (eine davon rechts im Bild!)
30m weit ins Meer hinaus
und werden durch einen 3m hohen und ca. 4m breiten Damm verbunden, der wiederum
3m unter der Wasseroberfläche liegt. Was das einmal war, weiß keiner genau -
vielleicht ein römischer Fischteich.
Svrsata: In die nordwestlichen Bucht
laufen 30m voneinander entfernt zwei Mauern parallel (eine davon rechts im Bild!)
30m weit ins Meer hinaus
und werden durch einen 3m hohen und ca. 4m breiten Damm verbunden, der wiederum
3m unter der Wasseroberfläche liegt. Was das einmal war, weiß keiner genau -
vielleicht ein römischer Fischteich.